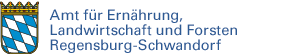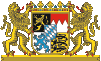Mit moderner Technik für sauberes Trinkwasser
„Wir müssen hier in Kiefenholz um jeden Tropfen Wasser kämpfen“, stellte Landwirt Johannes Weig bei der Besichtigung des Zwischenfruchtschauversuchs auf seinem Betrieb im Herbst 2025 fest. Wie hier Zwischenfrüchte helfen können, zeigte unter anderem ein Regensimulator. Weig ist als sogenannter Demobetrieb Partner des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Regensburg-Schwandorf. Ludwig Pernpeintner, Gewässerschutzberater am AELF, hatte Landwirte, Wasserwirtschaftsamt, Wasserversorger und Interessierte eingeladen, um den diesjährigen Schauversuch zu begutachten.
Die Besonderheit: Im Sommer wurden drei Parzellen mit einer Agrardrohne ausgesät. Mit durchschlagendem Erfolg. Es gab kaum Verunkrautung und auch beim Regensimulator konnte die Drohnensaat mit der herkömmlichen Sämaschinensaat mithalten.
Zwischenfrüchte: Wichtige Maßnahme für den Trinkwasserschutz
Weig hatte dieses Jahr ein Feld direkt neben der Autobahn und in Sichtweite des Pumphauses Ammerlohe ausgewählt. Die dortigen Brunnen sind ein wichtiger Teil der Trinkwasserversorgung der Gemeinde Wiesent, weshalb jüngst der dortige Gemeinderat beschlossen hat, das komplette Einzugsgebiet der Brunnen zum Trinkwasserschutzgebiet zu erklären. Gerade in Trinkwasserschutzgebieten sind Zwischenfrüchte ein wichtiges Mittel, um Nitrateintrag ins Grundwasser zu verhindern. Dies hob der Zweite Bürgermeister der Gemeinde Wiesent, Alfred Stadler, in seinem Grußwort hervor.
Drohnensaat ist der herkömmlichen mehrere Wochen voraus
Am 11. Juli 2025 – der Weizen stand noch auf dem Feld – war die Drohne von Drohnenpilot Michael Wiesent über die Ähren geflogen und hatte in drei Parzellen unterschiedliches Saatgut ausgestreut, das zwischen den Halmen auf den Boden fiel. Dort konnte es, geschützt unter dem Stroh des Getreides, das erst etwa eine Woche später abgefahren worden war, keimen, und profitierte schon von den Niederschlägen Mitte und Ende Juli, wie Ludwig Pernpeintner vom AELF bei der Besichtigung einordnete.
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
22. Oktober: Sämaschinensaat (l.) und Drohnensaat (r.); dazwischen Nullparzelle
Dieselben Niederschläge hatten Weig bis 10. August daran gehindert, auf den übrigen Parzellen die verschiedenen Zwischenfruchtmischungen mit der Sämaschine beziehungsweise mit dem Düngerstreuer auszusäen. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich im Bereich der Drohnensaat dagegen schon ein leichter grüner Flaum über das Feld erstreckt. „Jetzt im November haben die Parzellen, die nach der herkömmlichen Methode angesät worden waren, zwar aufgeschlossen, aber gerade in der kritischen Zeit des Augusts war der Boden lange unbedeckt geblieben“, so Pernpeintner.
Regensimulator zeigt: Drohnensaat nimmt Wasser genauso gut auf
Zwischenfrüchte sollen überschüssiges Nitrat aufnehmen und für die folgende Kultur, also zum Beispiel Mais, verfügbar machen. Besonders wichtig: Das Nitrat darf nicht ausgewaschen werden und so ins Grundwasser gelangen. Konnte auch hier die Drohnensaat gegenüber der herkömmlichen Methode bestehen? Dieser Frage ging Michael Lukas, Wasserberater am AELF Tirschenreuth-Weiden, nach, der einen Regensimulator mitbrachte. Er hatte vor Ort vier Bodenblöcke ausgestochen und ausgegraben:
- verdichteten Boden aus dem Vorgewende
- Boden der Nullparzelle des Zwischenfruchtschauversuchs, die nur von einzelnen wenigen Pflanzen bewachsen ist
- Boden mit Zwischenfrüchten aus der Drohnensaat
- Boden mit Zwischenfrüchten aus der Saat mit Sämaschine
Nun wurde für 3 Minuten ein Niederschlag von 30 Millimeter pro Quadratmeter simuliert. Je weniger und klareres Wasser in die Becher rinnt, desto besser. Hier schnitten die Bodenblöcke mit den Zwischenfrüchten, Drohnensaat wie Sämaschine, ähnlich gut ab. Es floss oberflächlich kaum Wasser ab, sondern es wurde fast alles vom Boden aufgenommen. Bei der Drohnensaat floss es zwar relativ schnell durch, doch war es sehr klar, also frei von Humuspartikeln, die mit Nährstoffen verknüpft Nitrat ins Grundwasser geschwemmt hätten. Test eindeutig bestanden, finden Michael Lukas, Ludwig Pernpeintner und Johannes Weig.

Bodenblock wurde ausgegraben

Vorführung des Regensimulators

Ergebnis: ohne Bodenbedeckung Erosion
Die Trendwende bei der Nitratbelastung ist möglich
Teile der Gemeinden Wörth und Wiesent lagen in den vergangenen Jahren auch im Roten Gebiet. Doch der Nitratwert in den Messstellen zeigte eine sinkende Tendenz, sodass dieses Gebiet bei der Neuausweisung nicht mehr als mit Nitrat belastet ausgewiesen worden wäre, wenn nicht das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts festgestellt hätte, dass die bayerische Ausführungsverordnung zur Düngeverordnung unwirksam ist
Bereichsleiterin Annette Dodel vom AELF sieht in der sinkenden Tendenz der Nitratwerte einen Erfolg: „Das ist ein Zeichen, für die erfolgreiche Arbeit dieses Demoversuchs, aber auch der Landwirtinnen und Landwirte, die mit ihrer verantwortungsvollen Bewirtschaftung eine Trendwende bei der Nitratbelastung geschafft habe.“ Zugleich ermahnte sie die Landwirte aber dranzubleiben. Denn die Düngeverordnung bleibt bestehen und auch die Gelben und Roten Gebiete werden wieder aus der Schublade kommen. „Bleiben Sie dran und schützen Sie weiterhin unser Trinkwasser!“, so ihr Appell an die Landwirte.
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden